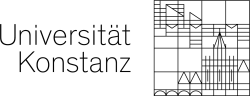Stabiler als gedacht

Die Weltwirtschaft lässt sich unter der US-amerikanischen Zollpolitik vor allem mit einem Wort beschreiben: Unsicherheit. Wie sieht aber die Lage aus, wenn wir uns die konjunkturellen Zahlen schwarz auf weiß anschauen? Das Ergebnis ist verblüffend:
„Es ist überraschend viel Stabilität da. Es herrscht keine wirkliche Krise des Welthandels.“
Gabriel Felbermayr, Direktor des WIFO in Wien
Sein Fachkollege Jan-Egbert Sturm, Direktor des KOF Instituts der ETH Zürich, stimmt zu: „Die Konjunktur läuft zwar nicht gut, aber weniger schlimm, als andere befürchten würden.“ Die beiden Spitzenökonomen waren zu Gast im Thurgauer Prognoseforum, einer Veranstaltung des Thurgauer Wirtschaftsinstituts (TWI). Das TWI ist ein An-Institut der Universität Konstanz und wird von der Thurgauischen Stiftung für Wissenschaft und Forschung getragen. In der Veranstaltung warfen die Ökonomen einen Blick auf eine Welt im handelspolitischen Umbruch – und zeigten, welche internationalen Auswirkungen die US-Handelspolitik tatsächlich hat.
Zwischen Nervosität und Normalisierung
„Es herrscht eine große Nervosität. Gefühlt hangeln wir uns von Krise zu Krise“, führt Gastgeber Urs Fischbacher, Leiter des Thurgauer Wirtschaftsinstituts, in die Diskussion ein. Das Schlüsselwort lautet hier „gefühlt“. Den drei Ökonomen auf der Bühne des Thurgauer Prognoseforums ist es wichtig, der gefühlten Wahrheit die tatsächlichen Zahlen entgegenzustellen. Die Veranstaltung war insofern ein großer Realitätsabgleich, ein Blick hinter die Kulissen. Und dieser zeigt: Ganz so schwarz, wie man glauben mag, sieht die aktuelle Lage nicht aus. Jan-Egbert Sturm möchte zwar keine Entwarnung geben, aber beruhigen:
„Ich will nicht von Wachstum oder gar von einem Boom sprechen. Aber es findet eine gewisse Art von Normalisierung statt.“
Jan-Egbert Sturm, Direktor des KOF Instituts der ETH Zürich
Das Geschäftsklima sei zwar nicht gut, doch die Länder hätten ihre Wege gefunden, mit der veränderten Situation und den hohen US-Zöllen umzugehen. „Unternehmer finden andere Möglichkeiten zu handeln“, so Sturm. Eine gewisse Handelsumlenkung sei daher zu beobachten, wenn Unternehmen neue Handelspartner abseits der etablierten, aber unzuverlässig gewordenen Geschäftswege suchen.
© Universität KonstanzEin realistischer Blick auf die Lage der Weltwirtschaft: Urs Fischbacher, Gabriel Felbermayr und Jan-Egbert Sturm (von links nach rechts) diskutierten die Auswirkungen der US-amerikanischen Zollpolitik beim Thurgauer Prognoseforum.
Mit Blick auf die Schweiz stellt Jan-Egbert Sturm einen spürbaren Stimmungswechsel aufgrund der US-Zölle fest. Das jüngst getroffene Abkommen zwischen der Schweiz und den USA, das insbesondere eine Senkung des Zollsatzes von 39 auf künftig 15 Prozent vorsieht, verspricht jedoch eine Entspannung der Situation. Die Gründe für die schwache konjunkturelle Entwicklung sieht Sturm allerdings nicht allein in den US-Zöllen: „Die Industrie in der Schweiz ist in einer Rezession, und das nicht erst seit jetzt, sondern schon seit zweieinhalb Jahren.“ Vor allem das verarbeitende Gewerbe sei schwer getroffen, der Pharmabereich stehe hingegen gut da. Sturms Fazit: Die Konjunktur in der Schweiz sei momentan unterdurchschnittlich, aber sie normalisiere sich. Wirtschaftliches Wachstum in der Schweiz, macht Urs Fischbacher mit Blick auf die Zahlen klar, sei derzeit vor allem auf Effekte der Zuwanderung zurückzuführen.
Gegenzölle oder nicht?
Wie also umgehen mit der misslichen Lage? Sollten die anderen Länder die US-Zölle akzeptieren oder dagegenhalten? Das Lehrbuch rate klar zu Gegenzöllen, schildert Gabriel Felbermayr. Dann seien hinterher zwar beide Länder ärmer, aber nicht so arm, als wären keine Gegenzölle erhoben worden. In der Praxis sehe die Situation dann aber doch komplizierter aus, räumt Felbermayr ein. Er beobachtet in dem aktuellen Handelskonflikt eine Vermischung von Marktargumenten und Machtargumenten. Die Ukraine sei zum Faustpfand der Verhandlungen geworden. Die Angst, dass die USA ihre Unterstützung für die Ukraine zurückziehen könnten, sei eine Triebkraft dafür, dass die Europäische Union nachteilhafte Handelsabkommen akzeptierte, die sie vor zehn Jahren noch nicht einmal diskutiert hätte. Leidtragende seien vor allem kleinere Staaten, macht Felbermayr deutlich. Große Länder seien besser in der Lage, handelspolitische Konflikte auszutragen. „Je größer die Länder, desto kleiner die Nachteile. Das ist ja auch logisch, die großen Länder handeln mit sich selbst.“
Ist der Freihandel also noch zu retten? Ein klares „Ja!“ gibt Felbermayr. Dies erfordere aber ein kluges wirtschaftspolitisches Agieren abseits der bekannten Pfade: „Es gibt kein echtes Drehbuch für das, was da passiert.“