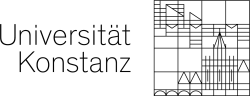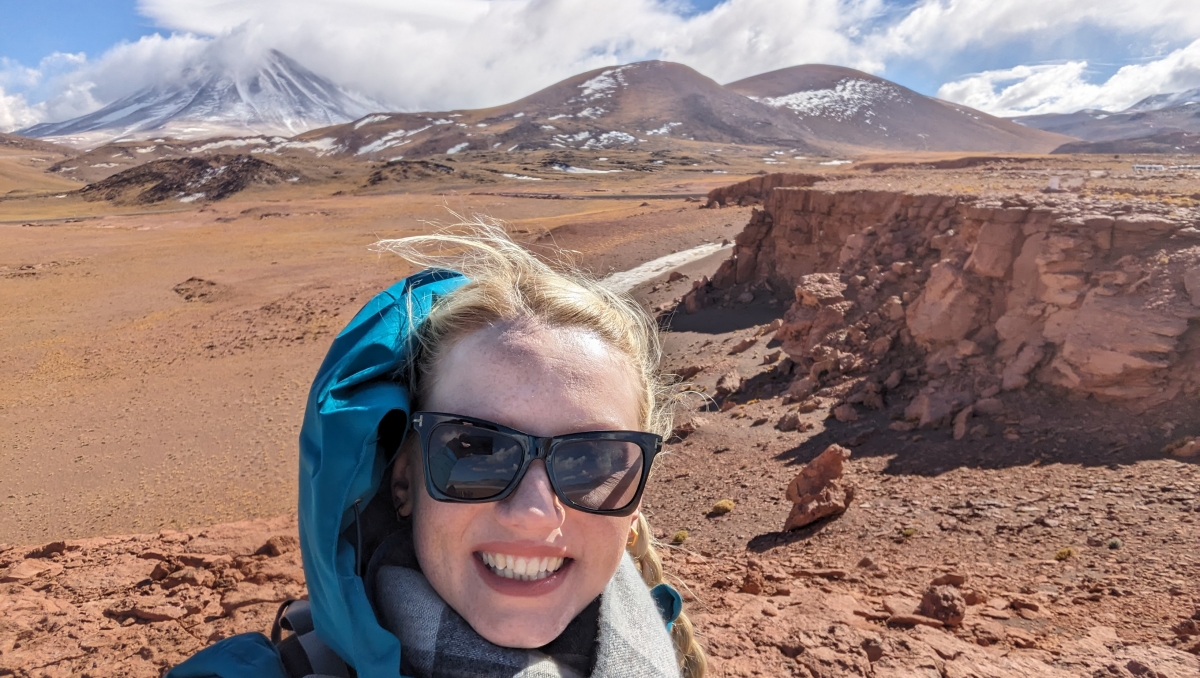Aus Daten werden Dialoge

Wie wirken sich die Folgen des Klimawandels auf Gesellschaften aus – vor allem dort, wo sie besonders stark zu spüren sind? Und wann führen diese Belastungen zu Protest? Diesen Fragen geht Viktoria Jansesberger, Postdoktorandin am Exzellenzcluster „The Politics of Inequality“ an der Universität Konstanz, in ihrer Forschung nach. Im Zentrum steht dabei das Zusammenspiel von Umweltveränderungen, gesellschaftlicher Ungleichheit und politischer Mobilisierung.
Im Gespräch mit uni‘kon gibt sie Einblicke in ihren Forschungsaufenthalt in Chile, erzählt von bewegenden Begegnungen im Feld – und reflektiert darüber, wie wissenschaftliche Erkenntnisse greif- und erfahrbar werden, wenn Theorie und Realität aufeinandertreffen.
Viktoria Jansesberger, warum Chile?
Viktoria Jansesberger: Ich hatte aus verschiedenen Gründen eine Präferenz für Lateinamerika. Es gibt seit zwei Jahrzehnten eine starke Forschungslinie zu „Climate Change and Conflict“ in der sogenannten „Security Group“ – Menschen, die sich schon in den frühen 2000ern oder späten 90ern Gedanken gemacht haben: Was passiert bei Umweltveränderungen? Kommt es dadurch zu Konflikten, gesellschaftlichen Spannungen, Migration?
Dabei war der Fokus stark auf den afrikanischen Kontinent gerichtet. Natürlich ist das super relevant – aber gleichzeitig sind auch viele asiatische und lateinamerikanische Länder stark vom Klimawandel betroffen. Chile ist besonders spannend, da es nicht nur von Extremwetter betroffen, sondern auch zentral für die grüne Energiewende ist – als weltweit größter Kupferexporteur und wichtiger Player im Lithiumabbau. Da sind viele verschiedene Probleme sichtbar, die mit Umweltwandel und Klimapolitik zusammenhängen.
© PrivatViktoria Jansesberger in Santiago de Chile. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Postdoktorandin am Exzellenzcluster „The Politics of Inequality“. Außerdem ist sie im Projekt „Investigating Climate Justice Preferences for Financing Instruments for Loss and Damage“ an der Universität Salzburg beschäftigt. Ihre Forschungsinteressen umfassen Klimawandel, Konflikt, politische Partizipation und Ungleichheit.
Wie sind Sie bei Ihrer Forschung vorgegangen?
Ich habe Daten zu Protestereignissen in Chile der letzten 15 Jahre zusammengestellt, und unsere Forschungsassistentin hat diese dann systematisch nach Protesten zu Umweltthemen, Wasser, Bergbau und Klimawandel durchsucht. Anschließend hat sie bei jedem Protestereignis recherchiert, wer das organisiert hat und welche NGOs beteiligt waren. Parallel dazu haben wir alle Unis in Chile durchforstet und geschaut, wer dort zu Umwelt-, Wasser- oder Rohstoffthemen arbeitet. So haben wir eine große Kontaktliste aufgebaut, die wir angeschrieben haben. Am Anfang waren wir nervös – aber die Resonanz war viel besser als erwartet.
Sie haben also mit ExpertInnen gesprochen – aber nicht mit zufällig ausgewählten BürgerInnen?
Genau. Es ging in dieser Phase nicht um eine breite Erhebung unter der Bevölkerung, sondern um die Perspektiven von Menschen, die in NGOs, Forschungseinrichtungen, Ministerien oder dem Journalismus arbeiten – Menschen mit Expertise, aber aus dem lokalen Kontext.
Gab es Gespräche oder Begegnungen, die Sie besonders beeindruckt haben?
Ja, zum Beispiel mit einer indigenen Journalistin, die seit 20 oder 30 Jahren einen eigenen Radiosender betreibt. Ihr Hauptanliegen ist es, über Umweltprobleme insbesondere im Zusammenhang mit indigener Bevölkerung zu berichten und diesen Menschen eine Plattform zu geben, weil sie sonst in den klassischen Medien kaum vorkommen.
Das war eine der Begegnungen, bei der ich wirklich das Gefühl hatte: Sie macht das nicht einfach nur als Beruf, sondern weil sie selbst betroffen ist. Sie kommt aus der Region, hat persönliche Erfahrungen mit den Umweltveränderungen gemacht. Sie hat viele Anekdoten erzählt, etwa darüber, wie Flüsse verschwinden, was sich verändert hat und wie machtlos man sich oft fühlt.
Podcast mit Viktoria Jansesberger
https://www.youtube.com/watch?v=x4JQORlPTCU
Ist die indigene Bevölkerung stärker betroffen?
Ja, absolut. Das ist einerseits beklemmend, andererseits wissenschaftlich spannend – weil sich diese Mehrfachbelastungen auch in den Daten abzeichnen. Wenn man sich anschaut, wer wo lebt, wo bestimmte Umweltveränderungen stattfinden, dann sind das oft Regionen, in denen marginalisierte Gruppen wohnen. Und wenn Gruppen, die eh schon marginalisiert sind, davon betroffen sind, sind die Auswirkungen natürlich gravierender. Gleichzeitig sehen wir auch, dass es gezielte Muster gibt, zum Beispiel wenn gerade an den Orten Mining betrieben wird, wo indigene Gemeinschaften leben – weil man dort mit weniger Widerstand rechnet oder die politische Stimme schwächer ist.
Diese doppelte oder dreifache Bürde trifft Gruppen, die ohnehin strukturell benachteiligt sind – sozial, politisch, ökonomisch – und dann zusätzlich mit diesen Umweltveränderungen konfrontiert werden.
Sie arbeiten normalerweise quantitativ – mit Daten, Tabellen, Modellen. Wie war es für Sie, nun auch in den persönlichen Austausch mit den Menschen zu kommen?
Total bereichernd, und ich würde gerne immer so arbeiten. Natürlich hat man nicht bei jedem Projekt die Möglichkeit, ins Feld zu gehen, aber was ich jetzt immer versuche: Zu allem, was ich in den Daten finde, illustrative Beispiele zu sammeln – um Dynamiken greifbar zu machen.
"Was ich dabei besonders spannend fand – auch im Hinblick auf meine eigene Forschung – war die Erkenntnis, dass die Ergebnisse aus meinen Datenanalysen nicht bloß statistische Konstrukte sind. Sie spiegeln tatsächlich Prozesse wider, die vor Ort passieren. Es war eindrücklich zu merken, wie sehr sich das, was in Zahlen sichtbar wird, mit den Erzählungen und Erfahrungen aus dem Feld deckt. Es ist auch hilfreich für das eigene Selbstverständnis. Manchmal zweifelt man ja, ob das, was man da statistisch herausfindet, wirklich Sinn ergibt. Aber wenn Menschen vor Ort genau diese Prozesse beschreiben, merkt man: Das stimmt schon, was ich da am Schreibtisch rechne."
Viktoria Jansesberger
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel beim Thema Mining. Unsere Arbeitshypothese war, dass Proteste dort auftreten, wo Lebensbedingungen durch Umweltveränderungen stark beeinträchtigt werden. Aber in Chile haben wir gesehen: Viele Proteste passieren dann, wenn neue Konzessionen verhandelt werden. Es geht nicht nur um die Zerstörung, sondern auch um die Verteilung von Ressourcen.
Ein Spannungsverhältnis, das mir vorher so nicht bewusst war: Viele Communities sehen Mining durchaus auch als Chance – Infrastruktur, Straßen, Mobilfunkmasten, Schulen, Gesundheitseinrichtungen werden oft erst durch Mining-Konzerne gebaut. Die übernehmen quasi staatliche Aufgaben. Gleichzeitig entstehen Folgeprobleme, wenn die Konzerne wieder gehen.
Das heißt, es braucht einen Aspekt von wahrgenommener Ungerechtigkeit – nicht nur eine objektive Verschlechterung der Lebensumstände?
Genau. Schlechte Bedingungen allein führen nicht zwangsläufig zu Protest. Erst wenn Menschen das Gefühl haben, dass es ungerecht ist, kommt es zu einer Mobilisierung – zum Beispiel weil andere profitieren oder der Staat versagt. Und es braucht sogenannte „critical time periods“ – also Momente, in denen sich etwas verändert oder verändern könnte.
Sie haben eingangs erwähnt, dass Chile nicht nur stark von Extremwetterereignissen betroffen ist, sondern auch als zentraler Player für die Energiewende eine Rolle spielt. Kommt es da nicht zu Spannungen zwischen Klima- und Umweltschutz?
Ja, das ist tatsächlich eines der großen Learnings, die ich aus dem Feld mitgenommen habe – und auch ein Interesse, das ich weiterverfolgen möchte. Ich hätte vorher nie gedacht, wie oft sich Klima- und Umweltschutz in der Praxis gar nicht so leicht miteinander vereinbaren lassen.
Beispiel erneuerbare Energien: Das klingt erstmal super – und grundsätzlich ist es das ja auch. Aber wenn man sich dann die Details anschaut, merkt man, wie komplex es ist. Der Abbau seltener Erden für Solarpanels und Batterien führt in manchen Regionen zu Wasserknappheit, Kupferabbau zu extremer Verschmutzung. In südlichen Regionen Chiles etwa hat die Lachszucht massive ökologische Probleme verursacht.
Auch Wasserenergie – also der Bau großer Dämme – war für mich so ein Punkt. Ich dachte immer, das sei per se gut. Aber vor Ort haben mir UmweltaktivistInnen erklärt, dass dadurch ganze Ökosysteme geflutet und unwiederbringlich zerstört werden. Man merkt dann: Viele Dinge, die man aus globaler Klimaperspektive als „positiv“ betrachtet, haben auf lokaler Ebene gravierende Folgen – gerade für Gruppen, die ohnehin schon benachteiligt sind.
Also ein klassisches Dilemma?
Ja, total. Und das bereitet mir auch persönlich Kopfschmerzen. Ich denke dann auch über mein eigenes Verhalten nach – was ich konsumiere, wie ich mich bewege, was ich unterstütze. Und es sind auch die Spannungsfelder zwischen sozialen und ökologischen Fragen, zwischen kurzfristigem Nutzen und langfristiger Nachhaltigkeit. Wenn Zugtrassen durch Wälder oder Feuchtgebiete gebaut werden, ist das klimapolitisch vielleicht sinnvoll – aber in Sachen Naturschutz problematisch. Auch unter Umwelt-NGOs herrscht da nicht immer Einigkeit, was priorisiert werden sollte.
Ist Ihre Forschung dadurch ein Stück weit ein „Call to Action“?
Schwierig. Natürlich ist meine Forschung politisch relevant – sonst würde ich sie ja nicht machen. Aber ich verstehe mich nicht als Aktivistin. Ich sehe meine Rolle eher darin, verlässliche, nachvollziehbare und möglichst realitätsnahe Informationen bereitzustellen, damit EntscheidungsträgerInnen fundierte Entscheidungen treffen können. Das heißt nicht, dass ich keine Haltung habe. Aber meine Aufgabe ist nicht, konkrete politische Empfehlungen zu formulieren, sondern eine fundierte Datenbasis zu schaffen, auf deren Grundlage dann politische Debatten geführt werden können.
Was nehmen Sie für Ihre zukünftige wissenschaftliche Arbeit mit?
Ich wurde darin bestärkt, dass Feldforschung wichtig ist – und Spaß macht. Ich habe unglaublich nette, kooperative und reflektierte Menschen kennengelernt. Das hat einen Schneeballeffekt: Diese Menschen kennen wiederum andere, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Man baut sich ein Netzwerk auf.
Wenn man einmal im Feld war, kennt man die Menschen, kennt ihre Geschichten – und sie tragen das auch weiter. Ich habe jetzt viele Kontakte, von denen ich denke: Wenn jemand eine Frage zu diesem oder jenem Thema hätte, wüsste ich genau, wen ich empfehlen könnte. Das finde ich wahnsinnig wertvoll – sowohl für meine Arbeit als Wissenschaftlerin als auch für mich als Person.
Über das Forschungsprojekt
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Climate Inequalities in the Global South: From Perceptions to Protests“ hat Viktoria Jansesberger zusammen mit dem Projektteam zunächst Daten zu klimabezogenen Protesten weltweit ausgewertet. Im Zentrum der Untersuchung stand die Forschungsfrage, wo es unter welchen Bedingungen zu Mobilisierung kommt. Aufbauend auf dieser quantitativen, also rein zahlenbasierten Analyse haben die Konstanzer Forschenden anschließend Chile und Südafrika für vertiefende Fallstudien ausgewählt.2024 führte Jansesberger Interviews mit ExpertInnen und AkteurInnen aus Zivilgesellschaft und Forschung in Chile. Diese Eindrücke bilden nun wiederum die Grundlage für eine anschließende Bevölkerungsumfrage – mit dem Ziel, Protestdynamiken im Kontext von Klimawandel und sozialer Ungleichheit besser zu verstehen.