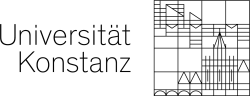Zelltod und Zellalterung in der Tumorbiologie

„Ohne Mutationen könnten sich Arten im Laufe der Evolution nicht anpassen“, sagt der Konstanzer Toxikologe und Biochemiker apl. Prof. Dr. Aswin Mangerich. Bei der Krebsentstehung gerät dieser Mechanismus in den somatischen Zellen (d.h. Zellen außerhalb der Keimbahn) jedoch außer Kontrolle.
Vereinfacht ausgedrückt entsteht Krebs durch Mutationen, über deren Entstehung der Körper die Kontrolle verloren hat und die zu einem unkontrolliertem Wachstum der Krebszellen im Körper führen. Im Idealfall bemerkt nämlich die Zelle anhand des Proteins p53, das wie eine Art Spürsonde fungiert, dass das in ihr enthaltene Erbgut geschädigt wird, und löst daraufhin gezielt den programmierten Zelltod aus. So kann die Krebsentstehung bereits in einem sehr frühen Stadium dadurch vermieden werden, dass kranke Zellen an der Vermehrung gehindert werden.
„Damit ist das Problem jedoch leider nicht immer gelöst“, sagt der Konstanzer Toxikologe Prof. Dr. Alexander Bürkle. Bestimmte Arten von Viren, darunter auch Papillomviren (HPV), die verschiedene Arten von Krebs erzeugen können, können diese „zelleigene Notbremse“ nämlich inaktivieren. „Das führt dazu, dass die Zelle immer größere Schädigungen erfährt, die wiederum Mutationen am Erbgut hervorbringen. In der Folge wird die Zelle immer ‚bösartiger‘.“
Unabhängig vom programmierten Zelltod haben Zellen auch die Möglichkeit, in eine Phase der Zellalterung einzutreten; der Fachbegriff lautet „zelluläre Seneszenz“. Entdeckt wurde dieses Phänomen vor fast 60 Jahren von dem US-amerikanischen Gerontologen Leonard Hayflick anhand von menschlichen Bindegewebszellen. Er beobachtete, dass junge Zellen sich zunächst effizient durch Zellteilungen vermehren können, diese Fähigkeit aber ab einer bestimmten Anzahl von Teilungen verlieren. Gleichzeitig gibt es auch charakteristische morphologische Veränderungen, die man im Mikroskop erkennen kann. Diese zelluläre Seneszenz tritt ein, wenn die sogenannte „Hayflick-Grenze“ von etwa 50 abgelaufenen Teilungen erreicht ist. Seneszente Zellen bleiben zumindest für eine gewisse Zeit am Leben, sind aber unfähig, sich zu vermehren.
Tumorzellen hingegen kennen eine solche natürliche Begrenzung ihrer Vermehrungsfähigkeit nicht: Weder altern sie, noch sterben sie ab. Ein Schlüssel zur ihrer „Unsterblichkeit“ liegt in den sogenannten Telomeren, den Endstücken der Chromosomen. Bei Menschen und anderen Wirbeltieren wiederholt sich in diesem Bereich des Chromosoms eine bestimmte Abfolge (Sequenz) von „DNA-Buchstaben“ (Nukleotiden), nämlich TTAGGG. In jungen Zellen sind die Telomere mehrere tausend Nukleotide lang. Diese Sequenz verkürzt sich jedoch bei normalen Körperzellen bei jeder Zellteilung um etwa 50 Nukleotide. Wird eine kritische Verkürzung erreicht, setzt die Zellalterung ein.
„Bei Tumorzellen hingegen passiert das nicht“, erzählt Bürkle. „Sie besitzen einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass verlorengegangene ‚Buchstaben‘ ersetzt werden können. Dieser Mechanismus heißt Telomerverlängerung und wird durch das Enzym Telomerase bewerkstelligt.“ Dieses Szenario läuft sogar weiter, wenn man entsprechendes Gewebe biopsiert – sprich aus dem Körper entnimmt – und in eine Zellkultur bringt. Aus diesem Grund können in der weltweiten Forschung auch heute noch Krebszellen in Zellkulturen genutzt werden, die den PatientInnen vor Jahrzehnten entnommen wurden. So zum Beispiel die sogenannten „HeLa-Zellen“, die aus einer Gewebeprobe eines Cervixtumors der US-Amerikanerin Henrietta Lacks aus dem Jahr 1951 stammen.
Weiterlesen: Zelltod durch Strahlen- und Chemotherapie – zwei Seiten einer Medaille (Kapitel 4 von 11)
Zurück zur Artikelreihe
Tullia Giersberg
Verwandte Artikel: