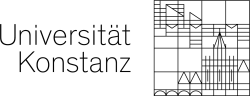Die Mammuts sind aus der Zeit gefallen

Mammuts sind seit Jahrtausenden ausgestorben – oder etwa doch nicht? Das Team rund um Umweltgenomikerin Laura Epp von der Universität Konstanz fand die DNA der urzeitlichen Riesen in nur wenige hundert Jahre alten Sedimentschichten sibirischer Seen. Sollte das stimmen, würde der Fund alle bisherigen Mammut-Erkenntnisse in den Schatten stellen und sogar ein kleines Stück Erdgeschichte neu schreiben.
Laura Epp und ihr internationales Team hielten sich mit dem Jubeln jedoch zurück. Hier konnte etwas nicht stimmen. Sind Mammuts nicht schon seit tausenden von Jahren ausgestorben? „Unter den Forschenden in diesem Bereich gibt es bereits seit einigen Jahren einen kleinen Wettlauf“, sagt Laura Epp. Während eine Studie von 2009 erstmals Funde von Mammut-DNA aus Sedimenten präsentierte, die über 1.000 Jahre jünger waren als die jüngsten Fossilien einer Festlandpopulation (ca. 10.500 Jahre alt), kamen in den letzten Jahren Funde aus Sedimenten hinzu, die gerade einmal 4.000 Jahre alt waren. Während das von einigen Paläontologen, die an sichtbaren Überresten von Mammuts forschen, wie Knochen und Elfenbein, kritisch gesehen wird, scheinen diese Befunde für die Forschenden an DNA aus Sedimenten recht sicher.
Aber so wirklich sicher kann man sich fast nie sein. Und genau deshalb müssen Forschende stets aufmerksam mit ihren Ergebnissen umgehen. Für die Erforschung der Vergangenheit unseres Planeten bedeutet dies, dass jedes gefundene Fossil und jede DNA-Spur stets nur eine Momentaufnahme darstellen.
„Forschung ist ein offener Prozess und man weiß nicht immer, wie es ausgeht. Daher muss man aufgeschlossen bleiben und bei Zweifeln entsprechend prüfen. Dann gibt es manchmal überraschende Ergebnisse.“
Laura Epp, Umweltgenomikerin
Um beim Beispiel Mammut zu bleiben: Ein einzelnes Tier einer wahrscheinlich recht großen Mammutherde ist vor Jahrtausenden verendet, wurde verschüttet und wird im Jahr 2024 von Forschenden entdeckt. Der Fund kann meist datiert werden. Doch damit ist nur den Todestag eines einzelnen Tieres festgelegt. Was ist mit der restlichen Herde? Wie lange haben diese Tiere noch überlebt, in wie vielen Generationen sich noch fortgepflanzt? Die ernüchternde Antwort lautet: Man weiß es nicht. Und so kommt es, dass Forschende sich immer wieder freuen, wenn sie bereits bekannte Funde mit jünger zu datierenden übertrumpfen können. „Aber Mammutfunde, die nur 200 Jahre alt sind? Da hätte ein Nachkomme des gefundenen Tiers im Prinzip noch schnaubend hinter uns stehen müssen“, sagt Laura Epp und lacht.
Das Team ging also auf Spurensuche, um herauszufinden, wie die DNA-Fragmente von gleich mehreren Mammuts in den Bohrkern kamen. Die Antwort auf diese Frage sollte auch in die Entscheidung einfließen, ob die 2019 in Sibirien gewonnenen und inzwischen in Konstanz im Labor untersuchten Proben überhaupt weiterverwendet werden durfte oder vielleicht kontaminiert sein könnte.
© Universität Konstanz / midnight motionIllustration von Laura Epp mit einem Koprolithen (linke Hand) und einer Bodenseeprobe (rechte Hand), die mit Hilfe eines Bohrkerns gewonnen wurde.
„Der Bohrkern wurde bereits im Sommer 2019 in Sibirien gezogen. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich die Lieferung nach Konstanz bis zum Oktober 2020. Die durchgehende Kühlung des Materials war sichergestellt. Trotzdem mussten wir natürlich doppelt kritisch auf unsere Ergebnisse schauen“, erzählt Peter Seeber, Postdoktorand in dem Projekt und Erstautor der Studie. Anfang 2021 lagen schließlich die ersten Untersuchungsdaten vor. Damit stand auch die Datierung auf ein Alter von etwa 200 Jahren fest und das Team begann mit der Untersuchung des Rentier-Anteils in den DNA-Rückständen.
„Unser Ziel war es eigentlich, die Weidewirtschaft mit Rentieren in diesem Gebiet über die letzten 200 Jahren nachzuvollziehen. Ist es auch immer noch. Doch dann stellten wir immer mehr Fragmente einer anderen DNA fest, die wir prüfen mussten und wollten.“
Peter Seeber, Postdoktorand in dem Projekt und Erstautor der Studie.
Nachdem eine falsche Lagerung bereits ausgeschlossen werden konnte und auch das junge Alter der Sedimente mittels einer radiometrischen Messung von Blei-Isotopen verifiziert wurde, musste das Team nun den nächsten Schritt in Frage stellen: die DNA-Sequenzen. Da in den Sedimenten lediglich (beschädigte) Fragmente von DNA und kein ganzer Strang eines kompletten Mitochondriums zu finden sind, müssen diese mit Methoden aus der Bioinformatik wie ein Puzzle zusammengesetzt werden. Vereinfacht ausgedrückt, fischt ein Computer aus einem Haufen von Puzzlestücken aus mehreren Puzzlen diejenigen heraus, die zum Mammutpuzzle gehören und klebt sie an einen virtuellen Referenzstrang, so dass sich an möglichst komplettes Bild ergibt. „Wenn die Fragmente aber zu klein sind, kann es passieren, dass das nicht sehr sicher ist, und die Interpretation nicht mehr stimmt. Das musste also geprüft werden“, erklärt Epp.
Mit Laura Batke fand sich eine Masterstudentin, die ihre Abschlussarbeit diesem Thema widmen wollte. Sie hat eine Mammut-spezifische Reaktion entwickelt, die im Grunde ähnlich wie ein PCR-basierter Corona-Test funktioniert. Nur dass der Test nicht bei einer hohen Virenlast, sondern beim Vorhandensein von Mammut-DNA anschlägt. Diesen Test hat sie anschließend in verschiedenen Schichten des Kerns angewendet, um zu sehen wie hoch die jeweilige Erbgut-Konzentration ist. „Meine entwickelten Tests haben nicht gleich angeschlagen. Da kamen zwischendurch schon mal Zweifel auf, ob es nicht doch nur ein winziger Zufallsfund war“, sagt Batke. Sie bewies aber Durchhaltevermögen, baute durch immer weitere Feinjustierungen die Genauigkeit ihrer Tests aus und wurde schließlich fündig. Sie konnte die Mammut-DNA sowohl mit der spezifischen Reaktion als auch in einer Mischung von DNA-Sequenzen einer Reaktion, die alle Säugetiere erfasst, nachweisen.
Da die Frage nach der Richtigkeit nun geklärt war, blieb noch eine letzte Frage: Wie kommt die DNA in die nur 200 Jahre alte Probe? „Wir haben parallel auch noch Pflanzenreste aus dem Bohrkern auf ihr Alter hin untersucht. Die können sehr zuverlässig datiert werden und waren teilweise tatsächlich mehrere tausend Jahre alt“, sagt Epp. Es befand sich demnach nicht nur das Mammut-Erbgut in einer jüngeren Schicht, sondern größere Massen von Lebewesen aus anderen, älteren Erdschichten. Das kann durch Eintragungen in den See geschehen, die vor allem aufgrund der zahlreichen Frost- und Auftauprozesse in Sibirien vorkommen können.
© Universität Konstanz, Inka Reiter„Die Gegend ist bekannt dafür, dass sich durch ständiges Auftauen und wieder Einfrieren die Sedimente permanent stark verlagern. Dadurch haben sich Ablagerungen aus deutlich älteren Schichten in jüngere verschoben. Die Mammut-DNA ist quasi in die falsche zeitliche Schicht gerutscht.“
Laura Epp, Umweltgenomikerin
Erklärfilm über die Forschung von Laura Epp und ihrem Forschungsteam
https://youtu.be/cTiVNMDIDbM?si=yq3r64NvVPQkKqyCGab Wollnashörner hier in Deutschland? Und was hat das alles mit einem uralten Häufchen Hyänenkot zu tun? In diesem Erklärvideo nimmt uns die Umweltgenomikerin Laura Epp von der Universität Konstanz mit auf eine spannende Reise in die Steinzeit.
Mandy Haugg
Verwandte Artikel: