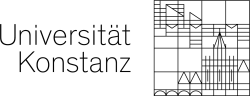Stechen oder nicht stechen?

Wann stechen Bienen und wie gelingt es ihnen, ihr kollektives Verteidigungsverhalten gegenüber Fressfeinden mit dem Schwarm zu koordinieren? Neue Erkenntnisse hierüber liefert ein interdisziplinäres Forscherteam von den Universitäten Konstanz und Innsbruck. In der Studie, die in BMC Biology veröffentlicht wurde, kombinierten die Wissenschaftler*innen Verhaltensexperimente mit einem innovativen Modellierungsansatz, der auf „Projektiver Simulation“ basiert. Sie zeigten, dass einzelne Bienen aufgrund der Anwesenheit und Konzentration eines Alarmpheromons entscheiden, ob sie stechen oder nicht. Die Forschenden gehen davon aus, dass die Stechwahrscheinlichkeit einzelner Bienen nicht konstant ist, sondern mindestens zwei interne Schwellenwerte für die Konzentration des Duftstoffes aufweist: einen, um mit dem Stechen zu beginnen, und einen, um mit dem Stechen aufzuhören. Die computergestützte Modellierung zeigte außerdem, wie verschiedene Umweltfaktoren die Evolution der Pheromon-basierten Kommunikation während des Verteidigungsverhaltens beeinflusst haben könnten. Zu diesen gehören die Prädationsrate, also wie häufig ein Bienenvolk Kontakt zu Fressfeinden hat, und die Breite des Spektrums an Fressfeinden.
Hohe Konzentrationen von Alarmpheromonen als Stoppsignal
Fühlt sich ein Honigbienenvolk bedroht, sei es von einem Raubtier oder von einem Menschen, der – versehentlich oder absichtlich – dem Bienenstock zu nahe gekommen ist, starten die Bienen einen koordinierten Gegenangriff. Dieser hat zum Ziel, das Volk zu verteidigen und den Eindringling zu verscheuchen. Ein wichtiges Signal für Bienen, den Eindringling anzugreifen und zu stechen, ist das Vorhandensein eines Alarmpheromons, das die Bienen an ihrem Stachel tragen. Im Falle eines Angriffs wird das Pheromon entweder aktiv – durch Wächterbienen – oder automatisch beim Stechen – durch rekrutierte Arbeiterinnen – verbreitet. Es trägt also nicht nur Information über die Anwesenheit eines Angreifers, sondern auch über das Ausmaß des durch die Bienen eingeleiteten Gegenangriffs. „Je mehr Bienen den Eindringling gestochen haben, desto mehr Alarmpheromon wurde mit jedem Stich freigesetzt und desto höher ist dessen lokale Konzentration“, erklärt Dr. Morgane Nouvian, Biologin aus Konstanz und gemeinsam mit Andrea López-Incera aus Innsbruck Erstautorin der Studie.
Um zu verstehen, wie einzelne Bienen des Volkes diese Informationen nutzen, um die Entscheidung zu treffen, zum Wohle der Kolonie zu stechen und dadurch möglicherweise zu sterben, beobachteten die Wissenschaftler*innen das individuelle Stechverhalten von Westlichen Honigbienen (Apis mellifera) aus drei Völkern. Mithilfe verschiedener Konzentrationen natürlichen und synthetischen Alarmpheromons und einer Fressfeindattrappe zeigten sie, dass die Aggressivität gegenüber der Attrappe – gemessen als Stechwahrscheinlichkeit – zusammen mit der Konzentration der Alarmpheromone zunimmt, bis sie einen Höhepunkt erreicht. Bei hohen Konzentrationen sinkt die Aggressivität jedoch wieder auf ein niedriges Niveau.
© M. NouvianDrohende Honigbiene (Apis mellifera)
Dies ist das erste Mal, dass eine solche abnehmende Aggressivität bei hohen Pheromonkonzentrationen unter kontrollierten experimentellen Bedingungen nachgewiesen wurde. „Eine mögliche Funktion dieses Stoppeffekts hoher Konzentrationen des Alarmpheromons könnte darin bestehen, das ‚Überstechen‘ bereits besiegter Eindringlinge und damit unnötige Opfer unter den Arbeiterinnen zu vermeiden“, schlägt Nouvian vor.
Der „Superorganismus“ als evolutionäre Einheit
Bei sozialen Insekten, egal ob Honigbienen oder andere soziale Arten wie zum Beispiel Wanderameisen, kommt es häufig vor, dass Einzelindividuen ihr Handeln auf das Wohl und Überleben der Kolonie ausrichten. Aus diesem Grund wirken evolutionäre Selektionsprozesse bei diesen Insekten auch auf Gruppenebene anstatt auf Ebene des Individuums. „Normalerweise, wenn ein Organismus stirbt, kann er seine Gene nicht mehr an die nächste Generation weitergeben. In einem Bienenvolk ist jedoch die Königin für die Fortpflanzung zuständig. Wenn eine andere Biene bei der Verteidigung des Bienenstocks stirbt, die Königin dadurch aber gerettet wird, pflanzt sich das Bienenvolk weiterhin fort“, verdeutlicht Nouvian. Da das Bienenvolk als ein einziger „Superorganismus“ wirkt, kann das Verhalten der zugehörigen Individuen nur durch das kollektive Ergebnis, zu dem es beiträgt, verstanden werden.
Um die experimentellen Ergebnisse unter Berücksichtigung dieser Besonderheit der Evolution kollektiver Verhaltensweisen weiter auszuwerten, verwendeten die Wissenschaftler*innen einen auf sogenannter Projektiver Simulation basierenden Modellansatz, der ursprünglich von dem Mitautoren Prof. Dr. Hans Briegel und seinen Kollegen aus Innsbruck entwickelt wurde. In dem agentenbasierten Modell verfügt jeder Agent beziehungsweise jede „Biene“ über einen sehr begrenzten Fundus an für das Abwehrverhalten relevanten Wahrnehmungen – die Konzentration des Alarmpheromons und ein Signal, dass der Räuber flieht – und Handlungen – zu stechen oder nicht zu stechen. „Unsere Idee war es, ein Modell zu bauen, das realistisch, aber möglichst wenig komplex ist“, erklärt Prof. Dr. Thomas Müller, Professor für Philosophie an der Universität Konstanz und Mitautor der Studie. Er fährt fort:
„Wir simulierten so ein Kollektiv dieser Agenten, die nacheinander aufgerufen wurden, um den aktuellen Pegel des Alarmpheromons zum jeweiligen Zeitpunkt wahrzunehmen. Wenn eine ‚Biene‘ daraufhin zusticht, erhöht sich die Konzentration des Pheromons und die Entscheidung der nächsten ‚Biene‘ basiert dann auf diesem neuen Pheromonlevel.“
Ein zweiter wichtiger Aspekt des Modells ist, dass es eine Lernkomponente enthält: Weder die Reaktionen der einzelnen Bienen noch die Regeln der Interaktion zwischen ihnen sind vorgegeben. Stattdessen entwickeln sie sich „evolutionär“ über viele Zyklen der Simulation oder, anders ausgedrückt, über viele Generationen des Kollektivs. „Wenn die Entscheidungen der einzelnen Agenten unter bestimmten Umweltbedingungen vorteilhaft für das Kollektiv sind, werden sie positiv verstärkt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Generation von Agenten unter identischen Bedingungen ähnlich handelt“, verdeutlicht Müller. Insgesamt ermöglichte der agentenbasierte Ansatz durch dieses „Verstärkungslernen“ auf Gruppenebene die Modellierung des beobachteten Verteidigungsverhaltens der Honigbienen sowohl aus der Perspektive der einzelnen Bienen als auch des Kollektivs.
Das Modell auf dem Prüfstand
Unter Verwendung des Modells und verschiedener Parameterkombinationen konnten Vorhersagen über den möglichen Einfluss von Umweltfaktoren auf das Verteidigungsverhalten der Bienen gemacht werden. Zum Beispiel legen die Simulationen nahe, dass sich die Bienenvölker an den stärksten Räuber anpassen, dem sie begegnen. Das bedeutet, dass Bienenvölker, die vor allem auf schwache Räuber, wie Mäuse oder Kröten, treffen, bei hohen Pheromonkonzentrationen seltener stechen als Bienenvölker, die häufiger auf starke und schwer abzuschreckende Räuber, wie Bären, treffen. „Für das Überleben der Kolonie ist es absolut sinnvoll, in der Lage zu sein, mit dem jeweils gefährlichsten Raubtier der Gegend fertig zu werden. Auch wenn das bedeutet, einige der schwächeren Raubtiere gegebenenfalls zu stark anzugreifen“, beschreibt Nouvian.
© M. NouvianZunächst nimmt die Aggressivität der Bienen mit steigender Konszentration des Alarmpheromons (grüne Wolken) zu, bis sie einen Höhepunkt erreicht. Bei sehr hohen Konzentrationen, nachdem der Angreifer besiegt wurde, fällt sie dann jedoch auf ein niedriges Niveau zurück.
Die Wissenschaftler*innen wandten ihr Modell auch auf den Fall der wegen ihrer Aggressivität berühmt-berüchtigten „Afrikanischen Biene“ an. Es wird vermutet, dass diese Unterart der Westlichen Honigbiene ihr hochaggressives Verhalten als Reaktion auf höhere Prädationsraten und hochspezialisierte, schwer abzuschreckende Raubtiere, wie den Honigdachs, entwickelt hat. Tatsächlich ergab die Simulation, dass Bienenpopulationen, die unter einer hohen Prädationsrate sowie Räubern, die eine hohe Anzahl von Stichen einstecken können, leiden stärkere Verteidigungsreaktionen entwickeln als Populationen, bei denen dies nicht der Fall ist.
Wie geht es weiter?
„Wir waren sehr glücklich darüber, dass unser Modell die aktuellen Hypothesen dazu, wie sich die höhere Aggressivität der ‚Afrikanischen Bienen‘ entwickelt haben könnte, stützt. Einer der nächsten Schritte wird es sein, empirische Daten von echten Bienen in Afrika zu sammeln, um die Ergebnisse zu verifizieren“, gibt Nouvian einen Ausblick. Ein weiteres Projekt für die Zukunft ist die Modellierung einer vielschichtigen Bienenpopulation. Wie bereits erwähnt, gibt es mindestens zwei verschiedene Typen von Bienen, die am Verteidigungsangriff eines echten Bienenstocks beteiligt sind: Wächterinnen und rekrutierte Arbeiterinnen. „Im aktuellen Modell folgte jede Biene des Kollektivs dem gleichen Entscheidungsprozess. Ein Modell mit zwei verschiedenen Typen von Agenten zu trainieren und es mit experimentellen Daten zu vergleichen, wäre sehr interessant“, fügt Müller hinzu. Generell ist der vorgestellte Modellierungsansatz sehr vielseitig und kann auf andere Verhaltensweisen oder auch Tierarten angewendet werden. Er stellt somit ein wertvolles neues Werkzeug für die Untersuchung der Evolution von Kollektivverhalten dar.
Das Projekt wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK), dem österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF), dem Zukunftskolleg der Universität Konstanz und der VolkswagenStiftung gefördert.